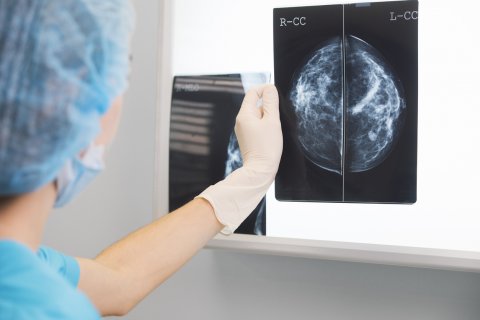Die Wahl der richtigen Therapieform entscheidet
Eine neue Studie macht sich die Spitzenmathematik für die Präzisionsmedizin zu Nutze.
Welche Waffe in der Therapie bei Brustkrebs gewählt wird, hängt von der Bestimmung der Rezeptoren für Östrogen, Progesteron und HER2 ab. Das wird derzeit mittels Immunhistochemie (IHC) als Gold-Standard durchgeführt. In 5 bis 10 Prozent aller Fälle kann diese Untersuchung von Tumorgewebe aber zu falsch negativen oder falsch positiven Ergebnissen führen – mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen.
Ziel: Eine maßgeschneiderte Therapie
In einer interdisziplinären Kooperation haben Wissenschafter der MedUni Wien nun nachgewiesen, dass man die diagnostische Sicherheit mit einer neuen Untersuchungsmethode deutlich erhöhen kann – und zwar indem man die Gen-Expression der Rezeptoren auf einem Gen-Chip überprüft und dann alle Daten in einem mathematischen Modell zusammenführt und ein gemeinsames Ergebnis ableitet. Christian Singer, Mitglied des CCC (Comprehensive Cancer Center) und Leiter des Labors für erblichen Brust- und Eierstockkrebs und Leiter der Senologie an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien dazu: „Weil der Rezeptorstatus weiterhin einer der wichtigsten Tumorbiologischen Parameter darstellt, ist Hinzunahme von molekularbiologischen Daten zur klassischen Immunhistochemie ein Schritt hin zu einer noch exakteren Tumorcharakterisierung.“
Falsch positive Messergebnisse bei IHC potentiell lebensbedrohlich
Zum Hintergrund der Studie: Sind einer oder mehrere Rezeptoren, die wie ein Motor den Brustkrebs antreiben, nachweisbar, ist die Antihormontherapie die richtige und wirksame Therapie. Sie blockiert diesen Prozess und bringt die Rezeptoren zum Erlahmen. Eine vergleichsweise belastende Chemotherapie mit vielen Nebenwirkungen ist nicht nötig, könnte aber ohne lebensbedrohliche Folgen angewendet werden. Hat die IHC jedoch ergeben, dass keiner der Rezeptoren vorhanden und der Brustkrebs ohne deren „Antrieb“ entstanden ist, so wird üblicherweise eine Chemotherapie durchgeführt. Dramatisch wird es dann, wenn die IHC durch einen Messfehler ein „falsch positives“ Ergebnis gebracht hat, also wenn eigentlich gar keine Rezeptoren vorhanden sind, obwohl der Test etwas Anderes ergeben hat und daher die Hormontherapie gewählt werden würde. „Dann kann der der Irrtum lebensbedrohlich sein“, sagt Wolfgang Schreiner vom Institut für Biosimulation und Bioinformatik.
Für jeden Rezeptor eigenes Gen-Modell
Um die Sicherheit bei der Feststellung des Rezeptor-Status zu erhöhen, haben sich die Bioinformatiker an der MedUni Wien Daten von 3.241 Patienten aus 36 klinischen Studien angeschaut und für jeden Rezeptor ein Gen-Modell entwickelt. Schreiner erklärt dazu: „Vor der Bildung des Eiweißstoffes für den Rezeptor liefert das Gen zunächst eine RNA-Kopie, die sozusagen den ‚Bauplan‘ für den Rezeptor darstellt. Mit Hilfe des Gen-Chips können wir nachweisen, ob diese RNA-Kopie im Tumorgewebe vorhanden ist. Das ist ein wichtiger Marker.“ Gleichzeitig wurden jeweils auch so genannte Co-Gene identifiziert, die im Gen-Netzwerk am zweitstärksten mit der Rezeptorbildung zusammenhängen. Die Informationen aus der IHC und aus der Expression der Rezeptor-Gene sowie der Co-Gene wurden in ein solides, mathematisches Modell gegossen, mit dessen Hilfe man ziemlich genau falsche Befunde ausschließen kann.